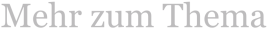Die Steine des Anstosses
Asklepios Klinik Hamburg Altona – ein hohes, mächtig anmutendes Gebäude. Es steht um die Ecke von mir, ist sozusagen mein Nachbar. Wann immer ich abends mit der S-Bahn oder mit dem Auto in die Stadt fahre, oder im Dunkeln nach Hause komme, schaue ich auf die erleuchteten Fenster. Und immer beschleicht mich dieses Gefühl, glücklich und dankbar zu sein, dass ich nicht einer von denen bin, der dort irgendwo hinter einem Fenster bangen. Wer dort sein muss, ist krank... hat einen Eingriff vor oder hinter sich, hofft, dass die Schmerzen endlich nachlassen, dass die Ängste hoffentlich bald weniger werden. 80.000 ambulante und stationäre Patienten vertrauen sich hier jährlich der Hochleistungs-, aber auch der integrativen Medizin an. Und die Geschichte der Klinik reicht bis in das Jahr 1784 zurück, als Altona noch zu Dänemarkt gehörte .
VERRÜCKT GENUG MUSS MAN SCHON SEIN…
Hinter einem dieser Fenster sitzt Prof. Dr. med. Wolfgang Schwenk, Chefarzt in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, dem Zentrum für minimal-invasive und onkologische
Chirurgie. In seiner Abteilung werden alle chirurgischen Erkrankungen des Bauchraumes und der endokrinen Drüsen behandelt. Mit kleinsten Schnitten bewältigt er, wo immer möglich, die größten
Herausforderungen: Tumore der endokrinen Drüsen, bösartige Erkrankungen der inneren Organe und des Darms.
Nach einem langen, mehr als 12-stündigen Arbeitstag sagt er mir in seinem Büro: "Wer Chirurg ist, muss verrückt sein! Aber wenn man verrückt ist, ist das der schönste Beruf der Welt. Ich würde nichts
anderes machen wollen. Dieser Beruf ist meine Leidenschaft. Es ist täglich eine neue Faszination und Herausforderung, Menschen zu helfen." Seine Augen blitzen.
Es ist schwer vollstellbar, dass sie je Langeweile oder Überdruss ausgestrahlt haben. Tausende Tage seines Lebens hat der Chirurg, der es regelmäßig auf die Liste der Besten schafft, im OP verbracht. Bevor Prof. Schwenk vor fünf Jahren als Chefarzt nach Hamburg-Altona kam, war er jahrelang Geschäftsführender Oberarzt und Stellvertretender Klinikdirektor an der Charité in Berlin.
Das Spektrum der Krankheitsbilder ist in seiner Abteilung besonders groß. Denn die Viszeralchirugie reicht vom Hals bzw. der Schilddrüse bis hinab zur Leiste und zum Darmausgang. Klein und immer kleiner hingegen werden inzwischen die Narben, die die Ärzte hinterlassen. Sie sind längst nicht mehr vergleichbar mit den säbelzahntigerartigen Schmissen, die Patienten noch vor 20 Jahren davontrugen. Und schon sind wir mitten im Thema mit dem Professor, der diese Techniken virtuos beherrscht.
WENN DIE GALLE HILFE BRAUCHT
Zu einem der häufigsten Eingriffe in seiner Klinik und zudem qualitativ besten in Deutschland, glaubt man der Fokus-Liste, gehört der Eingriff an der Gallenblase, deren Steine deutschlandweit 200.000-mal pro Jahr entfernt werden müssen. Wer einmal die Schmerzwellen erlebt hat, die die vergleichsweise kleinen Biester durch den Körper jagen können, ist meist froh, wenn er das Organ los ist. Die Gallenblase ist zwar nicht lebenswichtig, doch sie spielt dennoch eine durchaus wichtige Rolle bei der Fettverdauung. In der Gallenblase wird der aus der Leber stammende, bittere Saft gesammelt und konzentriert. Nach den Mahlzeiten wird er an den Darm abgegeben, damit das Nahrungsfett gut verdaut werden kann.
Da der Gallensaft ziemlich aggressiv ist, verwundert es nicht, dass die Gallenblase häufig erkrankt. Besonders häufig entstehen Gallensteine aus dem konzentrierten Verdauungssaft und infolge davon kann es zu den oben genannten schmerzhaften Koliken und Entzündungen kommen.
"Die laparoskopische Operationsmethode ist inzwischen die bevorzugte Methode zur Entfernung der Gallenblase. Etwa 90% aller Gallenblasen-Operationen finden auf diese Weise statt. Sie gehören zu den Operateuren, die noch den sogenannten ,großen Bauchschnitt‘ gelernt haben - wo liegt der Vorteil der minimalinvasiven Operation?", fragen wir den Professor. "Da gibt es nicht nur einen Vorteil ... das sind gleich mehrere", antwortet der Experte. "Ich denke, die laparoskopische Operation ist ein wahrer Segen für die Patienten. Dank der kleinen Bauchschnitte haben sie danach weniger Schmerzen und kommen schneller wieder auf die Beine. Sie erholen sich rascher als nach einer konventionellen Operation, werden meist schon nach zwei bis vier Tagen aus der Klinik entlassen. Nicht zu unterschätzen ist auch der kosmetische Vorteil – es bleiben nur winzige Narben zurück, die kaum auffallen."
Gibt es auch Situationen , in denen die Gallenblase noch auf konventionelle Weise entfernt wird? Prof. Schwenk: "Nur bei schwierigen Entzündungen und Sonderproblemen. Wenn es beispielsweise während der minimal-invasiven Operation zu Komplikationen kommt, wird auf die offene OP-Methode umgestiegen." In manchen Fällen kann ein größerer Bauchschnitt aus einer früheren Operation zu Verwachsungen im Gewebe führen, die dann eine minimal-invasive Entfernung der Gallenblase unmöglich machen. Doch das ist eher die Ausnahme.
Es heißt oft, dass viele jüngere Chirurgen nur noch minimal-invasiv operieren können, dass sie bei einem großen Eingriff passen müssten...ist das ein Scherz? "Also, da hat es tatsächlich einen großen Wandel gegeben", räumt der Experte ein. "In meiner Anfangszeit musste man als junger Operateur mindestens 20- bis 30-mal ,offen‘ operiert haben, um minimal-invasiv operieren zu dürfen. Heute ist es genau umgekehrt. Heute lernen die Chirurgen erst einmal die Laparoskopie, bevor sie dann auch die große offene lernen. Aber es stimmt schon, viele Kollegen sind dadurch wesentlich geübter in der Laparoskopie.“
Und was ist, wenn der Nachtdienst-Operateur nur die eine Methode, nämlich minimalinvasiv, beherrscht?, haken wir nach. "Machen Sie sich da keine Sorgen", beruhigt er. "Wir haben nachts immer Operateure, die beides können."
Stimmt es, dass Chirurgen schneller mit der Laparoskopie umgehen können als Chirurginnen? Prof. Schwenk lächelt: "Da ist schon etwas Wahres dran, und es hat einen sehr einfachen Grund. Erfahrungsgemäß daddeln Jungs mehr mit Video-Spielen am Computer als Mädchen – und dadurch tun sie sich später dann leichter, die Laparoskopie fingerfertig umzusetzen." Doch durch die tägliche Praxis holen die Chirurginnen schnell auf.
DIE ENTSCHEIDUNG: Der Bauch ist es!
Es ist spannend, einem Mann zuzuhören, dem man vollkommen vertrauen muss, wenn man sich in seine Hände begibt. Nirgends ist man einem Menschen mehr ausgeliefert als bei einer Operation. Warum ist Wolfgang Schwenk, der berufen war, die Altonaer Chirurgen-Legende Prof. Wolfgang Teichmann abzulösen, überhaupt Arzt geworden? Hat sich das schon früh abgezeichnet?
Er wehrt ab. "Nein, nein. Lange Zeit habe ich sogar geglaubt, ich würde Journalist werden wie mein Vater und mein Bruder. In der Schule habe ich mich sehr für Geschichte und Politik interessiert. Später kamen dann naturwissenschaftliche Fächer wie Biologie und Chemie hinzu." Forscher zu werden schien deshalb ebenfalls eine verlockende Option zu sein.
Doch als der junge Schwenk dann nach dem Abi (Notendurchchnitt 1,2) ein Pflegepraktikum machte, wurde ihm plötzlich bewusst, wie wunderbar es ist, kranken Menschen zu helfen. Während des Medizinstudiums, zu dem er aufgrund seiner guten Noten schnell zugelassen wurde, schob er Nachtwache auf der Intensivstation und jobbte in der Notfallambulanz. Seine Doktorarbeit handelte von Gefäßchirurgie. "Und damit war dann auch die Vorstellung beendet, eines Tages als Narkosearzt zu arbeiten. Ich wusste: Die Chirurgie ist es! Sie ist meine Leidenschaft."
Innerhalb der vielen Möglichkeiten entschied er sich für die umfangreichste von allen: die Viszeral- (wörtlich: die Eingeweide betreffend) oder auch Bauchchirurgie: "Und das war die beste Entscheidung meines beruflichen Lebens."
Der erste Eingriff, den der junge Schwenk allein ausführen durfte, war der Klassiker auf diesem Gebiet: eine Leistenbruch OP. Gibt es Erinnerungen an dieses erste Mal? "Ja", sagt Professor Schwenk trocken, "der Mann hat überlebt…"
DIE FASZINATION, DIE NIE MEHR AUFHÖRT
Wir sind beim Thema – bei Leben und Tod. Wir sind aber auch bei der Faszination, Leben zu retten, die einen Chirurgen nie wieder loslässt!
"Wissen Sie", sagt Prof. Schwenk, "zu uns kommen Menschen mit einem gesundheitlichen Problem, das ihre Lebensqualität mindert, das möglicherweise sogar das Leben gefährdet. Und wir Chirurgen sind dank unserer Kunst in der Lage, das Problem relativ schnell zu lösen. Wir können wieder die Lebensqualität herstellen, nach der sich der Patient sehnt. Aber…"
Er hält einen Moment inne. Was ist das Aber?, frage ich nach.
"Aber", so Prof. Schwenk, "es gibt auch nichts, was einen so klein, so demütig machen kann wie die Chirurgie. In der Chirurgie erleben Sie ganz viel Genugtuung und Befriedigung, aber – ganz ehrlich – auch Verzweiflung. Da wälzt man sich nachts im Bett und fragt sich: Warum war das so? Was hätte ich anders machen können? Sollen? Müssen? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Warum ist das passiert?"
Gibt es Beispiele für solche schlaflosen Nächte? "Natürlich", nickt er.
Da war diese junge, 30jährige Frau, frisch verheiratet, Diagnose Bauchfellentzündung. Bis zum neunten Tag nach der Operation gab es einen exzellenten Verlauf. Doch dann kam es zu Darmbluten und die Patientin musste mehrfach nachoperiert werden. Monatelang lag sie auf der Intensivstation, elf Monate war sie in der Klinik, 70 Tage lang blieb ihr Bauch geöffnet, musste täglich ausgewaschen, gereinigt werden. Sie bekam künstliche Ausgänge. "Mein letzter Gang abends führte mich immer zu ihr", so Prof. Schwenk, "ich habe die Klinik NIE verlassen, ohne bei ihr gewesen zu sein. Die junge Patientin hat sich nie aufgegeben, die Familie hat die Frau nie aufgegeben... und ich habe die Frau nie aufgegeben." Es sind genau diese Momente, es ist genau diese Haltung, die den seidenen Faden, an dem das Leben so oft hängt, mit sanften Händen festhält. Nicht zu viel. Nicht zu wenig. Und vor allem nicht aufgeben.
Der Professor atmet tief durch, sagt: "Ich habe sie kürzlich wiedergesehen. Sie lebt ein fast normales Leben. Sie hat keinen künstlichen Ausgang mehr. Am Ende ist alles gut gelaufen. Aber es war ein langer Weg."
Gibt es so etwas wie die schönste Operation?
"Ich habe das mal gedacht", sagt der Mediziner, "aber mittlerweile bin ich klüger. Ich weiß, dass auch eine perfekte OP ein schlechtes Ergebnis haben kann. Das ist das Dilemma in der Chirurgie. Das ist das, was ich mit Demut meine. Deswegen gehe ich nie wieder aus dem OP mit der Erkenntnis, dass das eine perfekte OP gewesen ist. Ich warte den Verlauf ab und spreche dann vielleicht irgendwann von einem perfekten Verlauf."
Die medizinische Kunst, der geschickte Umgang mit dem Skalpell, ist die eine Sache, um Menschen wieder gesund zu machen. Wir nennen das schlichtweg medizinische Kompetenz. Aber wie wichtig ist die Gefühlskompetenz auf dem Weg der Genesung? Welche Bedeutung hat sie nach seiner persönlichen Erfahrung?
Die allergrößte – so sieht er das. Und er erzählt die Geschichte von der dankbaren Patienten, die jedes Jahr am OP-Tag zu ihm kommt und als Dankeschön etwas Selbstgebackenes oder eine Flasche Wein für seine Abteilung vorbeibringt. Er berichtet von einer Freundschaft, die sich zwischen ihm und einem Patienten in der Klinik entwickelt hat.
Prof. Schwenk: "Der Mann kam mit einem Krebs am Zwölffingerdarm zu uns. Ein Krebs quasi aus heiterem Himmel, ohne Vorzeichen, ohne Vorankündigung – ein Alptraum. Ich habe ihn dann operiert. Er hat mittlerweile alles gut überstanden, und die Freundschaft, die sich in der Klinik entwickelt hat, ist bis heute geblieben. Das sind die Momente, in denen ich ohne Wenn und Aber sagen kann: Ich habe einen tollen Beruf."
Aber eine Freundschaft zwischen dem Arzt und dem Patienten ist ja eher die Ausnahme, wende ich ein.
DER HEILUNGSFAKTOR MENSCHLICHKEIT
"Klar", sagt er. "Aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt – und das ist auch mein Erfahrungswert –, dass Menschlichkeit, Nähe, guter Kontakt zum Patienten den Genesungsprozess beschleunigen. Deshalb ist es mir für mich und unser Team ganz wichtig, ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Das Verhältnis zwischen Arzt und Patient muss stimmen. Schließlich muss der Patient dem Arzt vertrauen.“
Wie stellt man ein solches Vertrauensverhältnis her?
Prof. Schwenk: "Ich rede ja mit dem Patienten vor dem Eingriff. Nicht nur über seine Krankheit. Ich suche einen Zugang zu ihm. Über ein Buch auf seinem Nachttisch, ein Hobby, über Kinder, über irgendwelche Gemeinsamkeiten. Der Patient muss schnell spüren, dass ich mehr bin als ein weißer oder grüner Kittel, mehr als ein OP-Techniker. Das ist gerade für Tumorpatienten wichtig. Und wir? Wir versuchen jedem Patienten bewusst zu machen, dass wir hier nicht auf Unentschieden spielen. WIR WOLLEN GEWINNEN!"
Wir kommen zum Schluss, schließlich ist der Professor mittlerweile mehr als 14 Stunden in der Klinik. Ob er heute noch zum Laufen kommen wird... das ist eher fraglich. "Das Dritte, was wichtig ist – außer emotionaler Kompetenz und Interesse für den Patienten ", sagt er bevor wir uns trennen, "ist, selbstkritisch zu sein.Wer selbstherrlich ist, nimmt sich die Chance, besser zu werden. Aber ich kann mich nur verbessern, wenn ich mich selbst in Frage stelle. Und wir müssen als Chirurgen jeden Tag gut sein und immer besser werden. Schließlich vertrauen Patienten uns ihr Kostbarstes an – ihr Leben."