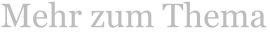Geborgen im Sterben
Es ist noch früh an diesem Morgen im September. Auf den letzten Rosen im verwunschenen Garten der Krefts glitzert noch Tau. Dr. med. Matthias Kreft hat um diese Zeit schon zwei Stunden Patientenbesuche im Pflegeheim hinter sich und noch 5 Stunden Besuche bei sterbenskranken Patienten im Hospiz oder bei ihnen zu Hause vor sich.
Westerstede: 53° 15′ N , 7° 55′ O, eine kleine Stadt im Ammerland, von der man noch hören wird… von der man bereits hört bis in den tiefen Süden der Republik. Der Grund: der preisgekrönte, ambulante Palliativ-Stützpunkt, den Matthias Kreft ins Leben gerufen hat und der Patienten die Möglichkeit gibt, dort zu sterben, wo 90 Prozent es am liebsten möchten: in ihrer vertrauten Umgebung, in der Geborgenheit ihrer Familien. Zu Hause.
GAB ES EIN SCHLÜSSELERLEBNIS? JA.
„Was mich immer sehr berührt hat, ist der Umgang mit Sterbenden; wie unwürdig es auch heute noch oft gehandhabt wird. Früher
hat man die Patienten in den Fäkalienraum der Kliniken geschoben, weil man nicht wusste, wie man sie sonst hätte verbergen sollen vor den Augen der anderen Patienten.“
Schon als kleiner Junge wurde Matthias Kreft mit dieser Realität konfrontiert. Hier, in der Schillerstraße 6, war er schon zu Hause lange bevor er geboren wurde. Sein Großvater Caspar, Chirurg
und ehemals Stabsarzt in der kaiserlichen Marine, gründete 1916 die Hausarztpraxis. Er war der Typ, der sein Fahrrad in Westerstede auf die Bahn lud, die 50 Kilometer nach Wilhelmshaven fuhr, um von
dort dann auf seinem Drahtesel Hausbesuche zu machen.
Sein Vater Jürgen setzte die Hausarzttradition fort: „Zu Weihnachten sind wir nicht in die Messe gegangen, sondern in das kleine Krankenhaus hier, wo mein Vater neben der Praxis auch als Chirurg
arbeitete. Dort wurden Heiligabend dann alle Kinder und Patienten, die nicht entlassen werden konnten, in einen Saal geschoben und unter einem riesigen Baum in der Mitte gab‘s die Bescherung.“
Wann wusste er, dass er Arzt werden wollte? frage ich. „Mit vier oder fünf“, lacht er. „Ich hatte nie das Bedürfnis, Lokomotivfüher zu werden.“
Obwohl die Hausarztpraxis auch in der dritten Generation lief wie geölt, war da diese innere Stimme. „2005 war die Situation der Palliativmedizin katastrophal. Es gab keinen Studiengang, 90 Prozent der Patienten starben in Krankenhäusern und Altenheimen, obwohl sie das nicht wollten, unter fürchterlichen, unwürdigen Umständen. Das wollte ich ändern.“
DER BEGINN EINER GROSSEN IDEE
Ein Gutachten der niedersächsischen Ärztekammer hatte 2005 ergeben, dass die Palliativversorgung flächendeckend vollkommen unzureichend war. Die erschütternde Bilanz ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. "2008 kam mir schließlich die Idee, die Palliativmedizin im wahrsten Sinne des Wortes nach Hause zu holen; einen Palliativ-Stützpunkt für das Ammerland und den Bereich Uplengen (südliches Ostfriesland) zu gründen." Und er wusste auch schon wie: "Über das Ärztenetz plexXon, dem 74 Haus- und Fachärzte angehören." Wie von einem unsichtbaren Faden gezogen, entstand aus diesem Ärztenetz heraus eine gemeinnützige GmbH, die die Trägerschaft für das Palliativ-Projekt übernahm.
Das niedersächsische Sozialministerium förderte den Stützpunkt mit 50.000 Euro. Am 1. Mai 2009 ging die ambulante Versorgung der Region ans Netz: rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.
„Der Landrat hier hatte dann 2010 die Idee, bei der EU Fördermittel für ein stationäres Hospiz mit 8 Plätzen gleich neben der Ammerland-Klinik zu beantragen." Noch im gleichen Jahr wurde es eröffnet. Und dann kam wie vom Himmel gesandt die Familie Müller/Rauffuss dazu, seit ihrer Flucht 1945 von Pommern ins Ammerland mit der Familie Kreft verbunden. Sie stellten das Stammhaus ihrer Firma zur Verfügung – die Rügenwalder Mühle – und bauten es zum gemeinsamen Büro von Palliativ-Stützpunkt und ambulantem Hospizdienst um. "Und sie bezahlen großzügigerweise auch noch die Nebenkosten."
12 Ärzte, professionelle Pflegekräfte, ehrenamtliche Helfer, Pflegedienst, Sozialdienste, Apotheker: Sie zogen alle am gleichen Strang und einigten sich auf ein interdisziplinäres System, in dem ein Patient selbst entscheidet, auf welchen der Bausteine er zurückgreifen möchte – und wo:
- den Palliativ-Stützpunkt, der die pflegerische und medizinische Versorgung koordiniert
- die Palliativstation der Ammerland-Klinik, wenn Beschwerden ambulant nicht zu beherrschen sind – mit der Option auf Rückkehr nach Hause oder auch ins Hospiz, wenn sich die Situation stabilisiert
- das Ammerland-Hospiz mit der 24-stündigen Pflege und Umsorgung in geborgener Atmosphäre, wen ein Patient allein ist oder die Familie pflegerisch entlastet werden muss
- und nicht zuletzt der ehrenamtliche Hospizdienst, der die Patienten und ihre Familien durch diese schwere Zeit begleitet.
Die örtliche Volksbank stiftete die ersten Autos für die Hausbesuche.
KRITERIEN ZUR AUFNAHME
Muss ein Patient bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um in dieses System eingeschleust zu werden? „Ja“, nickt Dr. Kreft, „und dabei arbeiten wir ganz eng mit dem behandelnden Hausarzt zusammen, weil wir möchten, dass der Patient sich auch weiterhin auf ihn beziehen kann. Die Hausärzte sind diejenigen, die Patienten für den Palliativstützpunkt empfehlen. Diese Patienten leiden an einer lebensbedrohlichen, chronischen Erkrankung. Sie sind pflegebedürftig, haben Schmerzen, brauchen psychosoziale Betreuung und auch spirituelle Begleitung… eine Versorgung zum Sterben hin.“
Er hält einen Moment inne. „An diesem Schnittpunkt ist es nicht mehr wichtig, wie die Krankheit heißt. Wichtig ist, die
Lebensqualität so hoch wie möglich zu halten. Und das würde manchmal noch besser gelingen, wenn man Patienten, deren Krankheit definitiv nicht geheilt werden kann, früher in das Palliativ-System
einschleusen würde.“
Solche Krankheiten sind zum Beispiel ein Glioblastom – ein besonders bösartiger Gehirntumor – oder ein kleinzelliges Bronchialkarzinom.
Im Hospiz sind aktuell 3 von sechs Patienten davon betroffen.
„In unserer Region im Ammerland kommen pro Jahr etwa 120 Patienten für die ambulante Palliativpflege infrage. Wir hatten
gehofft, im ersten Jahr etwa die Hälfte zu erreichen.“ Tatsächlich waren es im ersten Halbjahr bereits 90 sterbenskranke Menschen, die durch Veröffentlichungen, Flyer oder von ihren Hausärzten von
dieser Möglichkeit erfuhren.
Wie wurde die Fortbildung organisiert? „Das mussten wir selbst tun. Lehrgänge am Wochenende, Seminare zur Schmerztherapie, aber vor allem auch der einfühlsame Umgang mit Patienten – das wird heute
erst an einer einzigen Universität gelehrt.“
Gerade arbeitet er in einer Gruppe an einem Artikel über Ethikberatung in Deutschland. „In Pflegereinrichtungen wird der Wunsch des Patienten einfach oft nicht durchgeführt.“
ZEIT FÜR DIE VISITE
Wir brechen auf zum Hospiz… dorthin, wo alle wissen, das nun nur noch ein winziges Zeitfenster Leben und Tod der Patienten voneinander trennt. Fällt es ihm schwer, nur diesen Moment mit seinen Patienten zu haben? „Manchmal schon“, nickt er. „Manche kommen und finden nun endlich die Ruhe, die sie brauchen, um ihr Leben in Frieden gehen zu lassen. Aber manchmal ist es auch so, als hätte ein Mensch nur auf diesen Moment gewartet, in dem er hier ankommt... um dann gleich wieder zu gehen. Das ist schwer, weil wir ja gar keine Chance haben, sie kennenzulernen.“ So wie den Patienten, dessen Zimmer wir gerade betreten. Er kam und starb, unfassbar für seine Familie.
Und andere wiederum kehren nach einer kurzen Stabilisierung im Hospiz auch noch einmal für ihre letzten Augenblicke nach Hause zurück.
Nichts an diesem Ort erinnert an ein Krankenhaus. Warme Farben mit viel dunklem Rot, weiches Holz, wärmende Decken, ein herrlicher Blick ins Grüne. Manchmal stehen Rehe auf der Wiese vor den Fenstern. In jedem Zimmer ein breites Sofa, auf dem die Familie übernachten kann.
In jedem Zimmer, das wir betreten, bittet mich Matthias Kreft, mich hinzusetzen, nachdem er mich vorgestellt hat. Er tut das unabhängig davon, ob ein Patient bei Bewusstsein ist, ansprechbar, ob er oder sie ihm antworten kann. Er zieht sich einen Stuhl ans Bett, bringt sein Gesicht in die Nähe des Patienten, legt die Hand auf Schulter oder Hüfte und fragt ihn, wie es ihm geht. Wenn keine Antwort kommt, versucht er, so gut es irgendwie geht, die Körpersprache zu lesen, genau zu fühlen, ob derjenige Schmerzen hat, Hunger, eine unausgesprochene Qual.
Ich schüttele die schmale Hand von Herrn Ahrens, der seine letzte Kraft zusammen nimmt, um sich auf die Bettkante zu setzen. „Ich wünschte, wir hätten uns unter angenehmeren Umständen kennengelernt“, sagt er und ich bekomme eine Ahnung davon, wie charmant er gewesen sein muss und noch immer ist. Dr. Kreft erklärt ihm so genau die Vorgehensweise bei einer Opioid-Therapie – „wir möchten, dass Sie keine Schmerzen haben, sodass der Schmerzkreislauf gar nicht erst getriggert wird“ –, bis der Patient genau weiß, worauf er achten muss. Er wird im Hospiz von seiner Hausärztin besucht und betreut, die er voller Dankbarkeit als einen ganz außergewöhnlichen Menschen bezeichnet. Sie ist eine Insel im Sturm für ihn.
LEBEN NETTO
„Hier“, sagt Matthias Kreft, Vater von vier Kindern und, obwohl er noch keine 60 ist, Großvater von sechs Enkeln, „ist alles einfach nur reines, pures Leben.“ Wir besuchen eine Frau, kaum über 50, die niemanden hat als die Hospizmitarbeiter, die sie wie in einer liebevollen WG umsorgen. Eine andere Patienten, die überall an Knochenmetastasen leidet, aber deren Ursprungstumor man nicht finden kann – das sogenannte Cup-Syndrom.
Die Strahlentherapie hat zusätzlich einen Schlaganfall ausgelöst, der sie nun daran hindert, zu sprechen. Sie hat alle
Therapien abgebrochen. „Heute ist es schon viel besser“, sagt Dr. Kreft auf ihrer Bettkante und unterhält sich mit ihr über Händedruck. „Das war gestern noch unmöglich.“
Im nächsten Zimmer wartet ein Patient, der nach jahrelanger Abstinenz von seiner Familie nun nur noch einen Wunsch hat: seine Brüder zu finden und zu sehen, damit er mit ihnen einen Grabplatz
besprechen kann… wenn möglich in der Nähe der Eltern. Am nächsten Tag, seinem Geburtstag, wird einer der Brüder in der Tür stehen und ihn besuchen, weil Matthias Kreft ihn nachts im Internet
aufgespürt hat.
Im Raum der Stille steht über dem Gebetbuch eine immer weiter aufgefaltete Karte, auf der alle Menschen verzeichnet sind, deren Leben hier zu Ende ging.
Während ich Ortrud Kreft, mit der der Doktor nun schon fast 40 Jahre sein Leben teilt, nachmittags in die Trauergruppe der Kinder begleite – auch das ein Teil des Palliativ-Stützpunktes – schwingt er sich aufs Rad und besucht, wie einst der Großvater, seine Patienten. „Das ist für mich wichtig, um mich auszupusten und Klarheit in meine Gedanken zu bringen.“ Zum Beispiel für Gespräche mit Onkologen: „Wenn du sowieso stirbst und dann noch alle Haare verlierst und dir elendig schlecht ist… da muss man wirklich ehrlich sein und Patienten als Partner ernst nehmen. Sie sollten führend tätig sein, nicht der Arzt.“
WENN DIE ILLUSION ZUSAMMENBRICHT, KÖNNEN WIR PATIENTEN AUFFANGEN
Um eine insgesamt bessere Situation zu erzeugen, „sollte Palliativmedizin eine andere Wichtigkeit bekommen. Als behandelnde
Ärzte wissen wir ja sehr wohl, welche Tumorerkrankung wir z. B. heilen können und welche nicht. Wenn nicht, sollten Patienten auch die Zeit bekommen, sich darauf einzustellen; die Chance, sich der
Realität zu stellen und damit zu arbeiten.“ An ihrer Seite sind, wenn sie das wünschen, ehrenamtliche Helfer, die zuhören, Trost spenden, Halt geben. „Mir ist es ganz wichtig, die Würde des Menschen
zu achten. Es ist einfach wünschenswert, gemeinsam mit dem Patienten eine Entscheidung zu treffen. Und dazu muss man zum Beispiel auch den Hausarzt fragen, der die Familiengeschichte und die
Hintergründe kennt wie kein anderer.“
Was sollen Menschen tun, die nicht im Ammerland wohnen, um so betreut zu werden? „Zu einem ehrenamtlichen Hospizdienst Kontakt aufnehmen. Die müssten wissen, was zu tun ist. Patienten brauchen ja
nicht nur die Mediziner – sie brauchen das ganze Versorgungsnetz.“
Ich frage Matthias Kreft, wie lange die Menschen, die ich heute kennengelernt habe, noch leben werden. „Vielleicht ein bis drei Tage“, sagt er. Und es ist dieser Augenblick, diese ungeheure Zerbrechlichkeit des Lebens, die mich noch Wochen bis in meine Träume begleiten wird.
Das Video zur preisgekrönten, ganzheitlichen spezialisierten ambulanten Palliativversorgung im ländlichen Gebiet